„Babylon“ – der Beginn der Verständigung
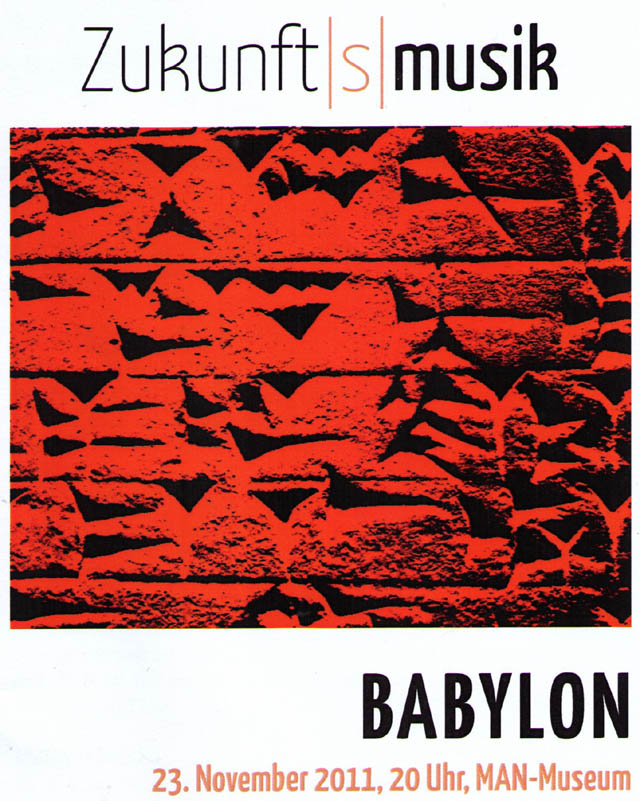
Neue Musik beim Festival der 1000 Töne mit einem spannenden Podiumsgespräch
Ein Abend gegen Vorurteile und Kurzschlüsse, ein musikalischer Abend, der Kopf und Seele gleichermaßen beschäftigte, und damit wieder ein voller Erfolg für „Mehr Musik!“ und das Augsburger Projekt „Zukunft(s)musik)“. Passen Ägypten und Neue Musik zusammen? Das Programm „Babylon“, zeigte am Mittwochabend im MAN-Museum, dass diese Frage völlig falsch gestellt wäre.
Mit „Night Falls“ des Iraners Arash Safaian eröffnete das Konzert, und da zeigte sich schon, dass ganz falsch lag, wer folkloristisch inspirierte Neue Musik erwartet hatte. Safaians Stück für Flöte, Klarinette, Horn, Vibraphon, Geige und Cello mag in alle möglichen Traditionen passen – vor allem wohl in die des Impressionismus – mit Arabien und Nordafrika hat es viel weniger zu tun als mit Debussy. Sphärisch, „harmonisch“ im weiteren Sinne, führte „Night Falls“ einen „Faun“ im modernen Gewand vor, berückend schön und beeindruckend versiert in der Handhabung moderner musikalischer Techniken und Sprachen.
„Ka Anna Ha“ des palästinensischen Israeli Samir Odeh-Tamimi klang da ganz anders, verstörend aggressiv schrie der Bassist Andreas Fischer einen Text des Dichters Mansur al-Halladsch ins Publikum, begleitete nur von ebenso kraftvollen Schläge auf die japanische Daiko-Trommel, die er selbst spielte – wütend und anklagend ist das Stück gemeint und ganz nahe an der Ereignissen des „arabischen Frühlings“, die derzeit Tag für Tag die Nachrichten füllen. Es geht um Gewalt, um Meinungsfreiheit, um Kampf. Aber ist dieses Thema ägyptisch, arabisch?
Gut, dass die Veranstalter eine kleine Talkshow organisierte hatten, ein Podiumsgespräch, moderiert vom Cellisten und „Zukunftsmusik“-Organisator Johannes Gutfleisch, der die anwesenden Komponisten nach den Wurzeln ihrer Musik befragte. Wo denn die Verbindung seiner Musik mit seiner Heimat liege, fragt Gutfleisch den Iraner Safaian. Das könne er gar nicht beantworten, antwortet dieser, solche Einflüsse verarbeite man unbewusst: „Ich verstehe mich als globalisierten Menschen, in dem alles verschmolzen ist.“ Anderes gesagt: Wieso eigentlich sollten arabische Komponisten traditionsverbundener komponieren als europäische?
Der europäische Cappuccino aus der ägyptischen Tasse
Ganz unberechtigt allerdings ist die Frage trotzdem nicht. Denn wie in den meisten kolonialisierten Ländern wurde auch in Nordafrika über Generationen hinweg die europäische Musik als das große Vorbild gelehrt und verehrt, gab es nach der Entkolonialisierung eine teilweise rückwärtsgewandte Orientierung an der folkloristischen Tradition. Komponisten der dritten Generation wie Safaian aber haben gelernt, sich von den Zwängen beider Seiten zu befreien und zu ihrer eigenen Musik zu finden. Neue Musik bedeute, „frei zu sein von Einflüssen, Zwängen und Regeln“, sagt Safaian und schränkt klugerweise gleich wieder ein: Natürlich habe er die Regeln des Komponierens gelernt, doch diese handwerkliche Ausbildung erst ermögliche es ihm, „noch freier zu sein.“ Und selbstverständlich wirkten die arabischen Traditionen in ihm – aber eben neben anderen, die er als Weltbürger mit aufgesogen habe. Safaian fasst diesen Prozess mit einem treffenden Bild: Die Musik der Emigranten sei „Musik von Ägypten und der Welt“, und dieser höre man ihre Herkunft eben noch an – so, wie man ihm selbst in Deutschland einen ägyptischen Akzent bescheinige, in Ägypten dagegen einen europäischen, so wie er seinen Cappuccino aus einer ägyptischen Tasse trinke.
Globalisierte Musik also mit arabischen Akzenten – Hansi Ruile vom „Festival der 1000 Töne“, in dessen Rahmen das Konzert stattfand, kann das ebenso treffend im soziologischen Jargon beschreiben. Babylon, das dem Konzert den Titel gegeben hat, stehe in unserem Verständnis allzu sehr für das Thema Verwirrung und Desorientierung – man könne diesen Mythos aber optimistischer auch als Beispiel für den Start in die Zivilisation lesen, für die – positive! –Entwicklung von Heterogenität und Vielsprachigkeit. Die Kunst steht Ruile zufolge in den vorderen Reihen dieser Entwicklung, Konzerte wie „Babylon“ setzten Zeichen, wie Kultur und Kulturpolitik in einer globalisierten Welt „ausschauen könnten“ – er hoffe aber auf weitere „Entnationalisierung“ auch in anderen Bereichen. Dass der Prozess fortschreitet, dass Kulturen ihre engen Verwurzelungen abstreifen und fernab der Heimat verschiedenste Transformationen durchmachen, diesen Prozess will Ruile in seinem Festival weiter begleiten – das nächste, überlegt er, könnten schon unter dem Thema „hybride Identitäten in der globalisierten Welt“ stehen.
Tohuwabohu und Synkopen, Venedig und Gilgamesch
Mit diesem Gespräch war nun die Musik des Abends in einen theoretischen Zusammenhang gerückt, der die Wahrnehmung der weiteren Stücke veränderte. „White Shroud“ von Ahmed Madkour begann mit vielstimmigem Tohuwabohu, in dem Strukturen nur mit großer Konzentration zu erkennen waren, und endete mit einer verklingenden orientalischen Melodie – eine Einschränkung möglicherweise des vorher Besprochenen, vielleicht ein Hinweis darauf, dass Tradition eben doch einen Orientierungspunkt bietet, wenn die Verständigung allzu schwierig wird.
„Three Moods“ des Ägypters Sherif Mohie El Din lieferte wunderbare – auch ironische? – Momente vor allem im ersten Satz, der zu Anfang a-capella gesungen wird. Bass und Bariton grundieren dabei mit einem höchst vergnüglich-verwirrenden, synkopisch vertrackten Rhythmus-Gerüst das Thema der Sopranstimme. Zwei weitere Stücke thematisierten zum Einen eine winterliche Gondelfahrt in Venedig, zum anderen eine Kampfszene aus dem berühmten Gilgamesch-Epos – wieder standen hier arabische und europäische Tradition ganz eng beieinander. Und wenn man bedenkt, dass die Mythen von Gilgamesch eng verwandt sind mit denen der Bibel – dann finden hier Stränge zusammen, die über Jahrtausende getrennt waren. Die naive Eingangsfrage jedenfalls hat „Babylon“ rigide beantwortet: In der globalisierten Welt passt Ägypten ebenso gut zur Neuen Musik wie Europa – es überwiegen längst nicht mehr die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten.







